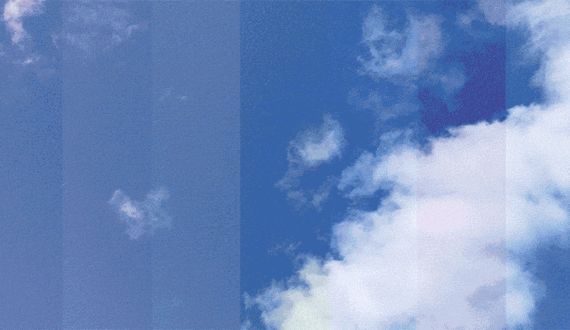Bei vielen Toten den einzelnen Verstorbenen würdigen und über Selbstbestimmung lernen
Es ist eins der Paradoxe des Todes, dass er gleichzeitig das Sicherste und Unsicherste ist, das uns Menschen passieren kann. Wir wissen, dass er kommen wird – die Frage ist nur: wie und wann?
Dass er auch in Form einer Hungersnot, eines Krieges oder eben einer Pandemie auftreten kann, war hierzulande fast schon wieder in Vergessenheit geraten und ebenso die Vorstellung, dass man mit viel zu vielen Toten auf einmal sowohl emotional als auch logistisch überfordert sein könnte.
Auch wenn das Coronavirus andere Länder härter getroffen hat als Deutschland, spüren wir eine neue Sichtbarkeit von Tod, diskutieren Sterblichkeitszahlen, machen uns Sorgen um uns selbst oder unsere Angehörigen; unsere Endlichkeit ist wieder stärker im Fokus.
Die Bilder von Kühltrucks und Massengräbern auf Hart Island (die es übrigens schon lange vor Corona gab) in New York City oder Leichentransporte durch das Militär im italienischen Bergamo haben wir hier nur in den Medien gesehen, aber sie haben sich auch in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt. Denn sie haben das Dazwischen sichtbar gemacht, das wir sonst gerne ausblenden: Das, was mit den Verstorbenen zwischen Sterben und Trauerfeier passiert.

In Deutschland wurden Menschen nur in Einzelfällen traumatisiert durch die Pandemie, doch wir wurden und werden als Gesellschaft und Individuen stark eingeschränkt und herausgefordert. Es ist die erste wirkliche Zäsur, die heutige Erwachsene kollektiv erleben.
Und auch wenn wir bisher keine Massengräber ausheben mussten, wurden unsere gewohnten Ritualketten durchbrochen, was uns verunsichert hat – auch in unseren Abschieden.
Innehalten nach einem halben Jahr mit der Pandemie
Was passiert mit unserer Sterbe- und Bestattungskultur?
Ein geschichtlicher Exkurs zu Pandemien
Um nach vorne zu schauen, lohnt sich ein Blick zurück. Große historische Einschnitte wie Pandemien haben die Menschen oft gesellschaftlich verändert. Die Große Pest galt lange als Strafe Gottes und sorgte dann für viel Zweifel an der göttlichen Weltordnung, als alle Buße und Selbstgeißelung nichts half.
Doch auch sepulkralkulturell beschleunigten Seuchen viele Entwicklungen – die Kremation wurde durch die Cholera vielerorts salonfähig.
Da es währenddessen meistens sehr schnell gehen musste und die Familien oft nicht dabei sein konnten bei den Beisetzungen, sieht man heute auf vielen Friedhöfen die nachträgliche Ehrung von Pandemieopfern durch Säulen oder Kreuze, die an die Toten der Pest, der Cholera, der Spanischen Grippe, und nun auch von Corona erinnern.

Diese Würdigung von Menschenleben im Nachhinein, wenn der Zeitpunkt der Überforderung vorüber ist, scheint fast so etwas wie ein Grundbedürfnis zu sein.
In Hamburg ließ man beispielsweise Verstorbene, die zu Zeiten der Cholera eilig verscharrt werden mussten, zu einem späteren Zeitpunkt ins Familiengrab umbetten.
Und Neapels Einwohner ordneten und putzten unzählige jahrhundertealte Knochen, ein Vermächtnis der Großen Pest, mit denen sie sich Andachtsplätze einrichteten, um der Opfer zu gedenken.
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Bestattungskultur
Auch heute gibt es beeindruckende Beispiele von Menschen, die von der Motivation angetrieben sind, Anderen die letzte Ehre zu erweisen, sogar wenn sie sie nie getroffen haben.
Es ist der dringende Wunsch, eine Erklärung für das Unfassbare zu finden.
Das sagt Diane Tempel-Bornett, Pressesprecherin des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. „Und es ist mittlerweile ja auch erwiesen, dass Kriegstraumata genetisch bis in die dritte Generation weitergetragen werden.“
Außerdem habe die Pflege der Gräber etwas Meditatives, meint Tempel-Bornett. „Als ich bei einem Workcamp in Polen einen Grabstein aus dem Ersten Weltkrieg geschrubbt habe, habe ich mir Gedanken über den Toten, der dort liegt, gemacht. Boris wurde nur 37 Jahre alt. Sicher hatte er Menschen, die ihn liebten und vermissten – und er selbst bestimmt auch andere Pläne für sein Leben.“
Namen statt Nummern also. So heißt auch das Buch von Cristina Cattaneo, die unermüdlich für die Identifizierung ertrunkener Flüchtlinge kämpft. Anhand von Narben, Tätowierungen, Zahnprothesen oder Knochenbrüchen macht sie den einzelnen Menschen aus – eine Pflicht zur Aufklärung, die sie verspürt und eine Frage des Respekts, auch gegenüber den Hinterbliebenen.
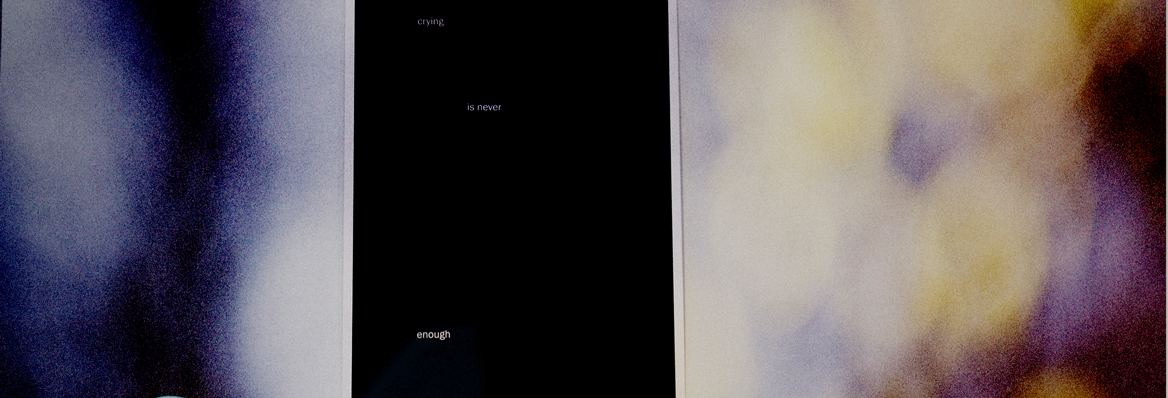
Ein Antrieb, den auch Mandy Herforth-Klöber, Bestattermeisterin und Thanatopraktikerin bei ANTEA Bestattungen (Teil der Ahorn Gruppe), gut nachvollziehen kann. Beim DeathCare Embalmingteam Germany e.V. – einer humanitären Hilfsorganisation, die weltweit nach Katastrophen, zum Beispiel nach dem Tsunami in Thailand 2004, ihre Hilfe bei der Versorgung und Identifizierung der Toten anbietet – gibt sie den Toten buchstäblich wieder ein Gesicht.
Dank ihrer Ausbildung ist sie in der Lage, Verstorbene anatomisch so zu rekonstruieren, dass einer Abschiednahme am offenen Sarg nichts im Wege steht.
Im Notfalleinsatz, zu dem Naturkatastrophen, aber auch terroristische Angriffe, Verkehrsunglücke oder Pandemien zählen, sind Menschen wie sie ‚im letzten Zelt‘ der Versorgungskette – eine Arbeit, die belastend, aber erfüllend sei.
Man arbeitet an einer Grenze, von der sich viele Menschen bewusst oder unbewusst fernhalten.
Das sagt Herforth-Klöber im Gespräch mit friedlotse. „Dabei kann man so viel für die Menschen tun. Wenn ich zum Beispiel jemanden einbalsamiere, damit er im Flugzeug überführt werden kann, sodass die Familie sich am offenen Sarg verabschieden kann, wird der Moment erträglicher in der Erinnerung und das ist gut für den Trauerprozess.“
Einbalsamierung – auch diese Veränderung der Bestattungskultur geht auf einen großen historischen Einschnitt zurück: Im Amerikanischen Bürgerkrieg wurden Soldaten entsprechend versorgt, um ihren Familien in einem besseren Zustand übersandt werden zu können. Die Prozedur, bei der das Blut der Verstorbenen mit einer Konservierungsflüssigkeit ausgetauscht wird, hält sich heute hartnäckig als amerikanischer Standard, auch wenn sie nur in besonderen Fällen wirklich gebraucht wird.
Die Fragen, die wir uns nun, während unserer eigenen großen, gesellschaftlichen Zäsur stellen müssen, sind also: Welche Dinge, von denen wir dachten, sie seien Standard, brauchen wir nicht mehr? Und wodurch können wir sie ersetzen oder ergänzen?

Wir werden gezwungen, über manche Dinge neu nachzudenken,
sagt Lea Gscheidel, Bestatterin bei Charon Bestattungen, im Gespräch mit friedlotse. „Dadurch, dass viele Trauerfeiern zum Beispiel draußen stattfinden mussten, wurde die Form fluider und auf eine Art familiärer. Das wird uns vielleicht auch bleiben.“
„Wo es früher hieß: ‚Bei uns steht die Urne immer in der Kapelle und von da aus geht’s los‘, musste es anders gemacht werden und auf einmal ging’s. Viele Friedhöfe und Bestatter mussten sich anpassen, fühlten sich erst überfordert, und manche waren dann nachher ganz beseelt von den neuen Möglichkeiten.“
Eine Art verbündender Effekt scheint einzutreten beim ‚gemeinsamen Feind‘ Corona, fast wie ein trotziger Wille zur Selbstbestimmung, zum Zusammenhalt und zur Mitgestaltung, auch wenn oder gerade weil die Umstände anders sind, als gewohnt
Das kann kreative Folgen haben: So fanden für eine Frau mit drei Lebensmittelpunkten gleich drei Trauerfeiern zur selben Zeit statt, um den Zugehörigen die Teilnahme während Corona zu ermöglichen.
Es kann aber auch noch weitergreifende Konsequenzen für Gruppen innerhalb der Gesellschaft haben, deren Widerstand gegen die Norm sich zusehends regt, jetzt, wo das erste Mal seit langer Zeit alles zur Debatte zu stehen scheint.
Nach Feminismus und Black Lives Matter nun endlich auch eine Bewegung zu mehr Selbstbestimmung in der Bestattungskultur?
So beschreibt es auch Benedikt Kranemann, Experte für Desaster-Rituale und Professor für Liturgiewissenschaft an der Katholisch-Theologischen Fakultät Erfurt: „Die Gesellschaft hat sich stark verändert. Sie ist in religiöser Hinsicht pluraler geworden, nicht nur aufgrund des Islams, sondern auch, weil es immer mehr Menschen gibt, die keiner Religionsgemeinschaft angehören oder unterschiedlichen Bekenntnissen folgen.
Das Spannende dabei ist, dass Antworten nicht von oben verordnet werden, sondern sich in der Praxis vor Ort herausbilden. Da findet eine Art Ökumene von unten statt.“
Das bestätigt eine lokale Lösung im Umgang mit Corona im Irak, wo es, wie in vielen anderen Ländern, aus Angst vor Ansteckung große Widerstände und Proteste gegen das Bestatten von Infizierten auf den lokalen Friedhöfen gab.
Die Behörden einigten sich mit dem schiitischen Großayatolla darauf, in ihrer heiligen Stadt Najaf einen neuen Friedhof anzulegen, auf dem alle Corona-Opfer beigesetzt werden. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes werden Schiiten, Sunniten und Christen in derselben heiligen Erde begraben.

Und auch hierzulande bestätigen jüngste Studien einen grundlegend veränderten Umgang der Gesellschaft mit Bestattung und Trauer, wie Barbara Rolf, Bestattungskulturbeauftragte bei der Ahorn Gruppe, kürzlich in einer internen Kolumne schrieb:
In dem Sammelband „Raum für Trauer – Erkenntnisse und Herausforderungen“, der vor Corona 2019 herauskam, kommen die Soziologen Thorsten Benkel und Matthias Meitzler zu dem Ergebnis, dass es die typische Bestattung inzwischen nicht mehr gibt, ebenso wenig den typischen Beisetzungsort oder die typische Trauerhandlung.
Und der Zukunftsforscher Matthias Horx beschreibt, wie verschiedene Lebensstile die Bestattungswünsche der Menschen heute prägen. Daraus resultiert seiner Erkenntnis nach, dass Bestatter mehr und mehr zu Kuratoren werden, die individuelle Begräbnisse achtsam inszenieren.
„Ich glaube, wir können uns trauen, die Zeichen der Zeit zu verstehen und anzunehmen“, schreibt Rolf.
Das Alte, das Bewährte und die Tradition gehen nicht verloren, doch Neues stellt sich daneben. Es hat die gleiche Berechtigung und die gleiche Wichtigkeit.
Vielleicht ist es das, was sich auch bei uns seit Beginn der Pandemie andeutet: Bei all den Herausforderungen und sicherlich auch belastenden Einzelschicksalen ist diese neue Zeit auch eine Gelegenheit, offen und mutig zu sein und einen zeitgemäßeren Umgang mit dem sichersten, unsichersten Thema der Welt zu finden.
Vor etwa einem halben Jahr haben wir den friedlotse-Blog mit einem Artikel gestartet, der zu Beginn der neuen Pandemie Rituale aufzeigte, durch die trotz Distanz Nähe entstehen kann. Sie gelten immer noch, zu Corona-Zeiten und darüber hinaus. Ihr findet den Artikel hier.
[Bilder: Angelika Frey]